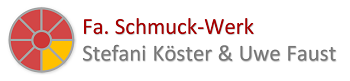Während meines Volontariats als Restauratorin im LVR Landesmuseum in Bonn (damals noch Rheinisches Landesmuseum Bonn, kurz: “RLMB”) erhielt ich den außergewöhnlichen Auftrag, eine Abformung einer römischen Bacchus-Figur anzufertigen.
Die so gewonnene Kopie sollte anschließend dazu benutzt werden, Repliken der Bacchus-Figur herzustellen, die im Museumsshop des RLMB vermarktet werden können.
Ich stellte zuerst eine Silikon-Abformung vom Original und anschließend auf der Basis dieser Vorlage eine Kunstharzkopie der kleinen römischen Statuette her. Diese Kunstharz-Abformung diente dann wiederum als Gussvorlage für die Reproduktionen.
Während die neuen Bacchus-Repliken noch heute im Museumsshop des RLMB angeboten werden, wanderte eine Replik (Bild oben rechts) zur Erinnerung in mein Atelier und der gute alte Bacchus (Bild oben links) wieder zu seinen römischen Freunden in die Vitrine der Dauerausstellung des Bonner Museums. 😉