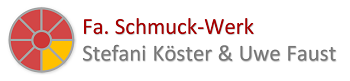Der Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom gilt heute gemeinhin als das größte und bedeutendste Goldschmiedeobjekt des Abendlandes. Die unermessliche Fülle und Qualität der Edelsteine, Gemmen, Kameen und der getriebenen Goldornamente und Figuren sowie die erlesene Feinheit des Emailleschmucks sind atemberaubend. Und nicht zuletzt die Fülle und Brillanz einer ganz besonderen Goldschmiedetechnik: Das Filigran.
Es war uns daher ein ganz besonderes Vergnügen, ein ausgesuchtes Beispiel dieses hochwertigen Filigranschmucks vom Dreikönigenschrein – dort zum Beispiel unterhalb der Figur des Heiligen Amos – auf einen Anhänger aus vergoldetem Silber zu übertragen.

Das Filigran aus gewalztem Perldraht, Kugelrosetten, Drahtkolben und kleinen Zierkügelchen gehört sicher zum aufwändigsten Ornament-Schmuck, der uns aus dem Mittelalter erhalten geblieben ist.
Auch bei unserem Anhänger wurde jedes einzelne Zierelement eigens von Hand angefertigt: Zuerst wurde der gekordelte und verlötete Filigran-Draht zu den dekorativen Ranken geformt und aufgelegt. Dann wurden die winzig kleinen Drahtkolben aus vorher extra geglühtem Silberdraht gewickelt und zwischen die Rankenornamente eingesetzt. Danach wurden alle Zierkügelchen durch Schmelzen von Silberdrahtstückchen einzeln angefertigt und in die End-Schlaufen der Zierranken eingelegt oder sogar vorher noch zu einer Blütenrosette zusammengeschweißt.
Ganz am Ende der langwierigen Vorbereitungen konnten alle Ornamente mittels Staublötung auf den Untergrund montiert werden, bevor der Anhänger dann mit einem satten Feingold-Überzug vergoldet wurde.

Im Zentrum des Anhänger findet sich noch eine weitere Besonderheit: Ein Indigolith, also ein sehr seltener blaugrüner Turmalin mit fabelhaften Einschlüssen in einer ebenfalls vom Dreikönigenschrein übernommenen mittelalterlichen Punzenfassung. Indigolithe zählen zu den edelsten und damit wertvollsten Turmalinvariationen. Der Schliff passt hier hervorragend zu einer mittelalterlichen Schmuck-Replik.

Unser Indigolith ist sogar zweifarbig, er kombiniert das sensationelle Smaragd-grün mit dem unvergleichlichen Turmalin-blau. Die dekorativen Einschlüsse des Turmalins sind typisch für diese besonderen Edelsteine.
Wie man deutlich sehen kann, haben wir auch hier erneut auf jede kalte technische Perfektion verzichtet. Mit einer spiegelglatten Oberfläche und exakt symmetrischem Filigran wäre ein mittelalterlicher Charme eines solchen Schmuckstücks nicht zu erreichen. Auch die Anhängeröse blickt eher leicht in Richtung ihrer rechter Schulter 😉 und die zentrale Fassung erinnert an eine wilde Schar Kinder, die sich an den Händen halten.
Die meisten unserer Kunden schätzen genau diese Treue zur originalgetreuen Patina der antiken Vorbilder. Daher verwenden wir sehr viel Zeit damit, uns bei der handwerklichen Umsetzung möglichst nahe dem Aussehen der Originalobjekte anzunähern. Wir hoffen, dass uns das auch bei diesem außergewöhnlichen Filigran-Anhänger wieder überzeugend gelungen ist.
Wie immer fertigen wir Ihnen diesen Anhänger – mit vergleichbarem Edelstein – gerne auch in Gold an. Bitte fragen Sie uns einfach danach…