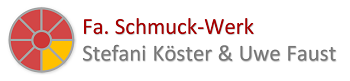Während meines Volontariats zur Restauratorin am damaligen Rheinischen Landesmuseum Bonn (heute: LVR LandesMuseum Bonn) bekam ich den wundervollen und für mich hochspannenden Auftrag, ein spätrömisches Glas mit Stichelgravur aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. einer umfassenden Restaurierung zu unterziehen.
Ich bekam das Glas in einzelnen Scherben direkt im Original-Fundzustand von einer Grabung im Raum Köln/Bonn.
Gemäß der damaligen allgemeinen Praxis für eine solche Restaurierung sollten die Fehlstellen farblich originalgetreu nachgebildet und damit die ursprüngliche Form des Glases wiederhergestellt werden.
Ich fertigte alle fehlenden Glasteile aus einem passend kolorierten Kunstharz an und ergänzte damit die Originalscherben.
Heute ist das restaurierte Glas ein fester Bestandteil der Dauerausstellung des LVR LandesMuseums in Bonn. Darauf bin ich ganz besonders stolz.